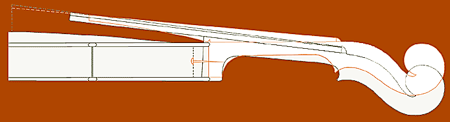Unterschiede zur modernen Violine :
Die Unterschiede der Barockvioline zur modernen Violine sind:
•schlankerer sowie anders platzierter Stimmstock
•kürzerer und dünnerer Bassbalken
-
•kaum angewinkelter Hals (in der Skizze ROT) - aufgeleimt und genagelt, nicht eingesetzt

-
•kürzeres Griffbrett, erst aus Buchsbaum-,
im 18. Jahrhundert aus Ahornholz oder Fichte gefertigt, mit Ebenholz furniert

•leichterer Saitenhalter; in der Regel auch aus Weichholz mit Ebenholzfurnier
•etwas dickere Decke
•Bespannung mit Darmsaiten (G-Saite meist mit Silberdraht umsponnen)
•bis zu 25% geringeres Gewicht
•andere Stegform, -höhe und -dicke

•eine tiefere Stimmung (415 Hz)
-
•unterschiedliche Bogenformen und -längen (siehe „Violinbogen“)
Anmerkung: in allen Details gibt es fast genauso viele Ausnahmen wie Regeln, bedingt durch regionale Gepflogenheiten, Experimentierfreudigkeit, ständiges Suchen nach Verbesserungen und Individualität.